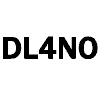
Basisfakten für den Notfunk |
|
Mittlerweile habe ich schon viele Konzepte für den Notfunk gesehen. Häufig sind das bestenfalls Themensammlungen dafür. Kaum zwei davon sind auch nur annähernd ähnlich. Meiner Meinung nach liegt das daran, dass praktisch alle irgendwo im luftleeren Raum anfangen. Dabei sehe ich eine klare Basis, die sich von Land zu Land nur geringfügig unterscheidet. Inhalt
Kaum jemand macht Notfunk, wenn er seine Familie nicht sicher und versorgt weiß.Die Basis jedes Notfunkkonzeptes muss deshalb sein, Funkamateure und ihre Familien zu Vorratshaltung und anderen Maßnahmen des Katastrophenschutzes anzuhalten. Deshalb schrieb ich zunächst das Kapitel Katastrophenvorsorge dieser Website. Ein wichtiger Grundsatz des Katastrophenvorsorge ist, im Ernstfall nicht blind wegzurennen, sondern nach Möglichkeit in der gewohnten Umgebung mit ihrer Infrastruktur zu bleiben. Natürlich muss man aus einem Überschwemmungsgebiet weg oder vor einem Waldbrand fliehen. Aber sonst ist man daheim am besten aufgehoben. Das gilt vor allem, wenn man keine 30 mehr ist oder Familie hat. Der BOS-Bereich will von uns kaum noch etwas wissen.Wer unbedingt bei Katastrophen vorne mit dabei sein will, soll Mitglied bei THW oder Feuerwehr werden. Nur dann darf er im Ernstfall auch bei einem THW/Feuerwehr-Einsatz teilnehmen. Ob er dann mit der gegebenen Infrastruktur Funk macht, ist ein ganz anderes Thema. Eine Freiwilligen-Organisation wie das THW ist auf die Fachkenntnisse und die Begeisterung der Aktiven angewiesen. Der BOS-Bereich ist hoch professionalisiert. Wenn der Amateurfunk da mitspielen will, muss er auch hoch profesionell arbeiten. dafür haben wir noch nicht mal das nötige Personal:
Führungspersonal ist da noch nicht mal dabei. Dieses Personal muss ggf. kurzfristig zur Verfügung stehen, ohne dass die Einzelnen, wie THW-Mitglieder, von ihren Arbeitgebern freigestellt werden müssten. Die BOS-Dienste kommen erst dann auf uns zu, wenn ihre eigene Kommunikationsinfrastruktur zusammengebrochen ist. Das passiert aber viel schneller, als vielen Verantwortlichen bewusst ist: Die Mehrheit der TETRA-Feststationen hat kein Notstromaggregat. Dann sind wir beim nächsten Punkt: Wir sind viele und wir sind schon da.Ausgangspunkt muss sein, die Funkamateure da abzuholen, wo sie gerade sind. Das ist meist die gewohnte Infrastruktur. Dazu gehört auch die Funkstation. Was ist aber der kleinste gemeinsame Nenner der meisten Funkamateure? Ein FM-Handfunkgerät! Die unterste Ebene des Notfunks muss deshalb auf dieser Technik aufbauen. In anderen Ländern kann der kleinste gemeinsame Nenner anders aussehen, z.B. SSB auf 80m. Für uns bedeutet das:
Was wir realistisch anbieten können ist nur das, was möglichst viele von uns haben und kennen. Nur eine Minderheit der Stationen wird wesentlich mehr bieten können. Möglichst alles auf den höheren Ebenen muss dann digitalisert werden, denn die Zahl der Stationen und vor allem die Menge des geeigneten Personals ist sehr begrenzt. Ob man dann Winlink, VarAC, JS8 oder sonst etwas nutzt, wird sich oft erst im Ernstfall zeigen, weil in vielen Gebieten keine Notfunkstrukturen exitieren. Die technische Basis ist aber fast immer die gleiche, weshalb ich den Artikel Drei Jahre "Notfunk ready" schrieb:
Wer es noch nicht erkannt hat: Wir werden wohl vorzugsweise Welfare-Traffic machen. Dafür sehe ich aber fast nirgendwo organisatorische Vorbereitungen. Welfare-Traffic ohne Einbindung in die lokalen/politischen Strukturen ist gefährlich.Halten wir erst mal fest:
Welfare-Traffic sollten wir nur in Abstimmung mit der Gemeinde o.ä. machen. Wir müssen die Bedingung stellen, dass entweder die Gemeinde zu übertragende Nachrichten entgegennimmt und an uns weiterleitet, oder die Gemeinde ein Minimum an Resilienz (Notbrunnen...) sicherstellt. Ansonsten wäre es für uns gefährlich, uns vonwegen Welfare-Traffic zu exponieren. Es gibt gute Beispiele, z.B. aus dünn besiedelten Gebieten der USA. Dort werden Krankenstationen oder andere öffentliche Gebäude mit Antennen und ähnlicher Installation versehen, auf dass der lokale Funkamateur nur noch seine Station mitbringen und anschließen muss. In der Ahrtal-Flut waren Bürger höchst aufgebracht, weil ihnen das THW nach zwei Wochen immer noch nicht geholfen habe. Nach der Flut in Valencia wurden Ministerpräsident und Königspaar von aufgebrachten Bürgern mit Schlamm beworfen. Tatsache ist: Im Ernstfall kommt die Hilfe immer zu spät und es ist immer zu wenig. Da hilft nur allgemeine Daseinsvorsorge auf vielen Gebieten! Es gibt Stellen, wo das alles schon geschieht.Ich bin längst nicht der einzige, der in dieser Richtung denkt:
War's das schon?Natürlich nicht! Aber weiterer Aufwand lohnt sich nur, wenn das in enger Absprache und mit finanzieller Unterstützung von Gemeinden, Land usw. passiert. Die erwähnte Amateurfunk-Vorbereitung von Krankenstationen ist nur ein einfaches Beispiel. In der Nähe von München wird schon länger über ein Projekt diskutiert, bei dem ein Landkreis und seine Gemeinden Standorte und Stromversorgung bereitstellen wollen, auf dass die Funkamateure ein recht dichtes Netz von HAMNET-Stationen errichten können. Die Funkamateure nutzen und warten das System, im Ernstfall hat der Landkreis ein relativ breitbandiges, völlig unabhängiges Kommunikationssystem. Dabei wird deutlich, dass die Funkamateure mit dem Notfallverkehr nichts mehr zu tun haben. Sie müssen nur einzelne Leute in Rufbereitschaft halten, damit sie sich um technische Probleme kümmern können. Weil diese Frage immer wieder gestellt wird: Ist da alles vom Amateurfunkgesetz gedeckt? Die Frage ist in diesem Fall nebensächlich: Der Katastrophenschutzbeauftragte darf im Katastrophenfall alles beschlagnahmen, was er glaubt brauchen zu können. Die beteiligten Funkamateure werden dienstverflichtet und tragen keine Verantwortung. Beispielsweise die verschlüsselte Datenübertragung verantwortet der Katastrophenschutzbeauftragte. |
|
Alexander von Obert * http://www.dl4no.de/thema/basisfak.htm Letzte Änderung: 20.09.25 (redaktionell überarbeitet und erweitert) |