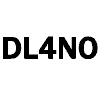
Notstromversorgung – Langzeiterfahrung |
|
Für die meisten Funkamateure bedeutet Notfunk eine außergewöhnliche Sitution, in der sie Portabel- oder Mobilbetrieb machen. Meine Station läuft seit einem Jahr nur so, wie ich auch Notfunk machen würde: Daheim, fast rund um die Uhr und immer aus den Akkus heraus. Mittlerweile habe ich das Problem weiter durchdacht und weitergehende Maßnahmen ergriffen. Inhalt
Zieldefinition
Schon die Zieldefinition für meine Notfunkaktivitäten unterscheidet sich vom üblichen Vorgehen: Ich bin jenseits des Alters, in dem man noch Katastrophen-Camping macht. Auch sehe ich nicht, dass der BOS-Bereich so schnell auf uns zurückgreift. Deren Rückfallebene nach Ausfall des Funks sind eher Melder, die durch die Gegend fahren. So die Aussage des Leiters der lokalen Polizeidienststelle. Deshalb bereite ich mich vor allem auf Welfare-Traffic vor. Das bedeutet, dass ich mich um meine Gemeinde bemühen muss, denn von meinen Möglichkeiten müssten die Bürger vorher wissen. Zuletzt wies ich meinen Bürgermeister darauf hin, dass er die Sirenenanlage eigenständig benutzen dürfe und was er damit tun könnte, siehe Verordnung über öffentliche Schallzeichen vom 15. Juli 1998 (GVBl. S. 509) , BayRS 2011-2-5-I, §2. Diese Information war offensichtlich neu für ihn. Einsatzzwecke hatten wir die letzten Jahre mehrfach, weil unser Wasserwerk so seine Probleme hat. Zuletzt sollten wir 9 Tage lang das Trinkwasser abkochen. In dieser Richtung würde ich gerne mehr tun. So haben wir dafür gesorgt, dass die BBK-Broschüre im Rathaus, in den Apotheken und einigen anderen Stellen ausliegt. Der Rest artet aber zum Bohren dicker Bretter aus wobei man darauf achten muss, nicht gleich in die rechte Ecke gestellt zu werden. Vollständig betriebsbereit bin ich für das Weiterleiten von Nachrichten über Winlink und andere digitale Betriebsarten auf Kurzwelle. So weit es FM-Relais mit Notstromversorgung gibt, könnte ich Nachrichten darüber aufnehmen und Antworten ausliefern. Die Alternative wären entsprechende Formulare, die Mitbürger ausfüllen und bei mir abliefern. Antworten könnte ich in gedruckter Form in der Nachbarschaft ausliefern. Dafür habe ich einen Drucker, den ich über meine Notstromversorgung betreiben kann. Am entsprechenden Formular arbeite ich, samt Datenschutzhinweis: Amateurfunk darf nur in offener Sprache betrieben werden. Das kann ich sowohl in andere Infrastruktur eingebettet als auch völlig eigeständig machen. Dazu sende ich z.B. per Winlink eine APRS-Positionsmeldung mit etwa folgendem Text ab: Winlink P2P VARA 3,586 VFO 9, 12, 15... UT, QRV DB0ZU DB0XF Dabei ist 80m tagsüber kein Fehler, ich gehe so dem anderen Notfunkverkehr aus dem Weg. Dafür habe ich eine NVIS-Antenne. 400 km funktioniert recht häufig. Der nächste Winlink-Knoten ist nur halb so weit entfernt. Mittelfristig überlege ich, meinen Internetzugang per Starlink zu betreiben. Ein Starlink Mini hat eine dafür akzeptable Stromaufnahme. Dann könnten Bürger ihre Notfallkommunikation vor meinem Haus stehend selber machen. Das funktioniert nur, wenn meine netzunabhängige Stromversorgung durchhält. Deshalb betreibe ich an der Funkanlage samt Funkcomputer kein einziges Netzteil. Wann immer ich daheim bin, läuft die Station rund um die Uhr, meist mit VarAC. Im Winter schalte ich alle paar Tage mal das Ladegerät ein. Sonst reicht mein Solarstrom. Aber auch dafür habe ich noch eine Rückfallebene. Reduzieren der LeistungsaufnahmeObwohl Akkus in den letzten Jahren einen enormen Preisverfall durchmachten, kostet das Speichern von 1 kWh immer noch weit über 100 EUR. Im Shack bedeutet das vor allem:
Aus Komponenten bauen und/oder eine Powerstation nutzen?Zu Powerstations für Funk-Notstrom schrieb ich schon eine eigene Seite. In Kurzfassung: Powerstations sind in aller Regel darauf optimiert, für relativ kurze Zeit große Leistungen zu liefern. Was den Wechselrichter betrifft, gilt hier in besonderem Maß der letzte Absatz. Auch für den 12-V-Ausgang ist in aller Regel ein Spannungswandler nötig: Meist enthalten Powerstations in Serie geschaltete 100-Ah-Zellen, die je 300 Wh nutzbare Energie speichern. Daraus kann man grob die Systemspannung der Powerstatio berechnen. Ein weiteres Problem sind die maximalen Akkuströme. Dadurch wird die Messgenauigkeit bei Akkuströmen im Bereich 100 mA recht gering. Man kann sich deshalb nicht auf die Ladeanzeige verlassen. Meine Powerstation schaltet bei einer 12-V-Belastung von 20-30 W bei einem angezeigten Ladezustand von etwa 45% ab, weil die Akkuspannung auf ihr zulässiges Minimum gefallen ist. Darauf kann man sich nicht verlassen. Wenn man zu etwas Handbetrieb bereit ist, kann man aber aus der Not eine Tugend machen, sofern die Powerstation etwa 13.1 V liefert. Das sind 12 V +10%, das sollten die meisten Geräte aushalten. Damit kann man seine Akkus nachladen – umabhängig ob AGM oder LiFePO4. Natürlich bekommt man die Akkus so nicht voll. Aber nach ein paar Stunden kann man die Powerstation wieder abschalten. Die Akkus halten dann noch eine Nacht durch und der Spannungswandler in der Powerstation läuft weniger. Wenn, wie oben beschrieben, die Powerstation unerwartet abschaltet, juckt das nicht mehr groß. Diese Probleme kann man natürlich umgehen, wenn man seine Notstromversorgung selber baut. Man kommt überall ran und kann alle Komponenten optimal auswählen. Beispielsweise können viele Powerstations nur mit Solarspannungen unter 30 V umgehen. Damit muss man extrem teuere Solarmodule nutzen. Ein 100 W-Solarmodul mit 18 V Nennspannung kostet mehr als ein gängiges 450-W-Modul, das bei 30-40 V seine Maximalleistung liefert. Bei einer stationären Installation will man vielleicht 2-3 Solarmodule in Serie schalten, damit man mit erträglichen Leitungsquerschnitten in den Keller kommt. Dann muss der Solar-Laderegler mindestens 120 V aushalten. Ein Vorteil einer Powerstation erschloss sich mir erst im Lauf der Zeit: Manche Powerstations beherrschen sehr hohe Ladeströme – wesentlich höher, als sich in einem 12-V-Eigenbausystem einfach beherrschen ließen: 1200 W / 12 V = 100 A! Bei begrenzten Ladezeiten, z.B. wenn das Stromnetz nur sporadisch funktioniert, ist das durchaus ein Vorteil. Gleiches gilt, wenn man seine Powerstation im Ernstfall irgendwo nachladen muss: Die hat einen Henkel, der Eigenbau nicht. DimensionierungsfragenDie zentrale Frage ist, wie viele Stunden man während eines Stromausfalls betriebsbereit sein will. Die minimale Ausbaustufe ist aus meiner Sicht sind 20 Stunden Betriebsbereitschaft. Dann kann man drei Wochen lang jeden Tag eine Stunde lang mit einem Handfunkgerät QRV sein. Das schafft man z.B. mit einem AGM-Akku der 20-EUR-Klasse, den man z.B. mit einem kleinen Solarmodul im Fenster kontinuierlich nachlädt. Die drei Wochen habe ich gewählt, weil ich einen Blackout einbeziehe – sehr unwahrscheinlich, dafür aber extrem gefährlich. Gängige Zeitschätzungen für das komplette Hochfahren des EU-Verbundnetzes sind 10-14 Tage. Dann muss aber die ganze Logistik erst wieder aufgebaut werden, vom Hochfahren der Rechenzentren bis zum Reinigen und Hochfahren der Molkereien usw. Das unter der Voraussetzung, dass genug Bauern Notstrom für Melkanlagen, Lüftungen usw. hatten. Den Aufwand kann man beliebig hochtreiben. Ein paar Gesichtspunte dazu:
RedundanzJede Notstromversorgung sollte redundant ausgelegt werden. Eine Kombination aus 1 Akku und 1 Ladegerät ist eindeutig nicht redundant: Sobald eine Komponente ausfällt, geht nichts mehr. Dehalb habe ich zwei im Prinzip unabhängige Notstromversorgungen, von denen eine im Normalfall den Kühlschrank versorgt und die andere die Funkstation – jeweils plus USB-Lademöglichkeiten usw. Beide Notstromversorgungen sind mit einer 4-mm2-Leitung verbunden, die 0,4 Ω Widerstand hat. Damit kann ich notfalls die Funkanlage aus dem Akku im Keller betreiben. Im Shack benutze ich bei Bedarf die Powerstation zum Nachladen der Akkus. Voll bekomme ich diese Akkus nur mit Solarstrom. Jede Notstromversorgung hat zwei gleiche Akkus, einmal je 100 Ah und einmal je 150 Ah. Jeder Akku hat seine eigene Sicherung. Ziehe ich die Sicherung eines Akkus, läuft die Notstromversorgung mit dem zweiten weiter und ich kann den ersten ausbauen – egal wofür. Im Keller habe ich zwei Wechselrichter, einen hochwertigen mit 600 W Dauerleistung und einen ganz billigen mit 2 kW Dauerleistung. Der Kühlschrank hängt am ersten. Über den zweiten nutze ich im Sommer den Solarstrom-Überschuss für andere Zwecke. Im Keller gibt es getrennte Schienen für die Akkus und Verbraucher. Zwei Minus-Schienen braucht die Akkuüberwachung, um die Lade- und Entladeströme messen zu können. Auf der Verbraucherseite benutze ich den einen Anschluss des Mess-Shunts, um die Hochstromverbraucher anzuschließen. Deshalb habe ich eine Brücke, um beide Schienen direkt verbinden zu können. Ich kann deshalb am Mess-Shunt rumschrauben, ohne die Notstromversorgung außer Betrieb nehmen zu müssen. Auf der Plus-Seite hängen Akkus und 2-kW-Wechselrichter an der Batterieschiene, von der aus eine 60-A-Sicherung zur Verbraucherschiene führt. Jede Strippe an der Batterieschiene hat einen Querschnitt von mindestens 16 mm2. An der Verbraucherschiene nutze ich Querschnitte ab 2,5 mm2. Das vermeidet, dass mir bei einem Kurzschluss Leitungen abrauchen können. Auf den Batterieschienen können bei einem Kurzschluss weit über 200 A fließen, ehe die Sicherungen auslösen. Aber es lohnt sich sowieso, die Leitungen weit stärker zu dimensionieren als von der Strombelastbarkeit her nötig – speziell in einem 12-V-System. 0,5 V Spannungsabfall kommen schnell zusammen. Weitere ErfahrungenIm Lauf der Jahre sammelte ich diverse Erfahrungen, die weit über den üblichen Notfunkbereich hinaus gehen. Damit verblüffe ich andere Funkamateure regelmäßig, aber der Zusammenhang ist klar: So lange die eigene Situation nicht gesichert ist, macht man auch sicher keinen Notfunk – eingefleischte Junggesellen vielleicht mal ausgenommen. Energieausbeute eines Inselnetzes optimierenVon Anfang an plante ich die Notstromversorgung als Inselnetz. Meine Installation enthält also bis heute keinen netzgeführten Wechselrichter. Natürlich kann ich so nicht alle Solarenergie ernten, die meine Solarmodule insgesamt liefern könnten. Darin sehe ich weder einen ökonomischen noch einen ökologischen Nachteil: Ein netzgeführter Wechselrichter würde sich nicht amortisieren und mit dem Einspeisen meines Überschussstroms würde ich nur das Stromnetz weiter destabilisieren. Das bedeutet nicht, dass ich solchen Verlusten tatenlos zusähe. Ich habe drei Wechselrichter laufen, mit denen ich Überschüsse nach Möglichkeit nutze.
Es gibt noch kleineren Optimierungsbedarf, aber insgesamt sehe ich meine Notstromversorgung als ziemlich runde Lösung. Erzielte EnergieausbeutePro Jahr brauche ich für Kühlschrank und Funkanlage noch etwa 20 kWh Netzstrom. So viel könnte ich an 10 Sonnentagen ernten, aber die fehlen halt zwischen November und Januar – abgesehen von der Abschattung der Solarmodule während dieser Zeit. Die eindeutig billigste Möglichkeit, diese Lücke während eines längeren Stromausfalls zu füllen, ist ganz klar ein Notstromaggregat. 20 kWh in Akkus zu speichern kostet auch heute noch wenigstens 2.000 EUR. In den letzten drei Jahren konnte ich rund 500 kWh/Jahr ernten. Exakt kann ich das nicht angeben, weil mein System in Fluss ist und ich bei der Powerstation die Ladeenergie nicht so einfach messen kann. Das reduziert unsere Stromrechnung um vielleicht 150 EUR/Jahr. Die Kosten bekomme ich so nicht herein, aber das war auch nie das Ziel. Pro Jahr speichere ich in den 300-Ah-Akkus (4 kWh) im Keller rund 200 kWh. In einer normalen Solaranlage würde man versuchen, die Akkus möglichst jeden Tag komplett zu leeren und wieder zu füllen. Das wären rund 1000 kWh oder Strom für 300 EUR. An den Akkus im Shack habe ich noch keine Messeinrichtung. Hier werde ich noch mehr Ausbauten machen. Nach konventionelle Maßstäben müssten auch meine Solarmodule mit 1 kWp installierter Leistung wesentlich mehr liefern. Dafür hätte ich sie aber völlig anders montieren müssen. Der damit verbundene Aufwand wäre aber völlig unwirtschaftlich, weil ich damit Profis beauftragen müsste, die mit einem Gerüst anrücken. Ich erfülle aber problemlos meine Forderung vom Anfang mit 500 Wh/Tag. Bei den heutigen Preisen für Solarmodule lohnt es sich nicht mehr, sie maximal auszunutzen. Unterbau, Kabel usw. kosten meist mehr als die Solarmodule. Weitere PläneVor allem im Shack gibt es noch Optimierungsbedarf. So läuft dort immer noch der 10-A-Laderegler, mit dem ich meine Experimente 2017 begann. Bis zur großen Renovierung im März 2022 lieferte er knapp 200 kWh, seitdem weitere 300 kWh. Ein 20-A-Laderegler wartet schon auf seinen Einsatz, dafür muss ich aber den ganzen mechanischen Aufbau erneuern. Dann werde ich meinen Rechner im Arbeitszimmer wohl über weite Phasen des Sommerhalbjahrs mit Solarstrom betreiben. Diverse Dinge möchte ich noch automatisieren. Davon ist bislang nur die Abschaltung des 2-kW-Wechselrichters im Keller verwirklicht: Das oben erwähnte 200-A-Relais schaltet ein, wenn der Ladezustand im Keller 85% übersteigt. Bei 80% schaltet das Relais wieder aus. Der Luftentfeuchter verbraucht rund 300 W, während der Laderegler oft über 400 W liefert. Bei sonnigem Wetter sorgen diese Parameter dafür, dass die Akkus trotz Luftentfeuchter voll werden und reichlich Reserven für schlechtes Wetter in den Akkus bleiben. Auch das Laden aus dem Netz möchte ich noch automatisieren. Dafür sehe ich zwei völlig getrennte Betriebsarten:
Zusätzlich habe ich noch einige Ideen, wie ich die Notstromversorgung mit der Hausautomatisierung verknüpfen könnte. Der erste Schritt wäre ein Spannungswandler auf 48 V, um mit PoE (Power over Ethernet) den Raspi der Hausautomatisierung und einige Teile der Hausvernetzung zu versorgen. |
|
Alexander von Obert * http://www.dl4no.de/thema/notstro5.htm Letzte Änderung: 16.08.25 ('eitere Ertfahrungen' ergänzt) |